Leo erobern
„Der Name Leopold“, lese ich an einem Sonntag auf dem Weg zum Leo, „setzt sich aus den althochdeutschen Wörtern liut= das Volk sowie bald= kühn und mutig zusammen.“ Benannt, erfahre ich, wurde der Platz nach dem Fürsten Leopold I., einem der bedeutendsten Feldherren seiner Zeit. Ich muss schmunzeln. Es passt zum Leopoldplatz, dass er nach einem Feldherrn benannt wurde. Schließlich scheinen hier alle auf ihre Weise tagtäglich kleine Schlachten zu schlagen: Die Anwohnenden und Ladenbesitzenden die vermehrte Vermüllung zu stoppen, die Polizei und das Ordnungsamt für Sicherheit und Ordnung zu sorgen, die Süchtigen neuen Stoff zu organisieren oder ihm fernzubleiben, und die Obdachlosen geschützte Stellen finden, um die immer kühler werdenden Tage und Nächte zu überstehen. Nach einer Weile als stille Beobachterin habe ich langsam das Gefühl, die Dynamiken auf dem Platz zu verstehen und erkennen zu können, wer zu welcher Gemeinschaft gehört, wer hier lebt, wer hier einen Laden besitzt oder in einem arbeitet, wer Drogen konsumiert oder trinkt, obdach- oder wohnungslos ist und wer sich nur auf der Durchreise oder auf kurzer Zwischenstation befindet. Die verschiedenen Gruppen mit ihren unterschiedlichen Interessen und Konflikten, Sorgen und Schlachten lassen sich sicher überall in der Stadt finden. Wohl nirgendwo sonst aber haben sie so viele Berührungspunkte: Die Süchtigen versammeln sich nicht nur vor einem Container neben dem Spielplatz, sondern konsumieren auch auf dem Spielplatz, im U-Bahnhof oder in den Hauseingängen. Die Obdachlosen sitzen oder liegen im und um den U-Bahnhof herum, auf den Betonbänken am vorderen Teil des Platzes genauso wie auf den kleinen Betonsitzen zwischen Müller- und Maxstraße, die bei genauerer Betrachtung Buchstaben sind und, wenn man sie abläuft, das Wort Leopoldplatzbilden. Oder Ztalpdlopoel.

Kleiner Austausch
„Salam Aleikum, grüß deinen Vater!“ Ein älterer Mann gesellt sich an den Stehtisch vor dem bereits geschlossenen Café Leo. Dort stehen seit Stunden vier weitere Männer. Ihr Minztee ist längst ausgetrunken und abgeräumt. Der eine hat einen Karton vor sich abgelegt, auf dem eine Heckenschere abgebildet ist, ein anderer eine durchsichtige Plastiktüte mit bunten Handyhüllen drin. Von ihrem Tisch wehen immer wieder Wortfetzen zu mir herüber. Dabei entsteht ein dystopisches Endzeit-Gedicht in Dada-Manier:
Salam Aleikum.
In dieser Welt schießen.
Meine Kinder, ich geh weg.
Alle weinen, ich mein Allah.
Mit Kindern reich.
Andere rauchen Gras.
Nichts mehr los.
Bruder tot. Alles tot.
Lebt mehr nicht.
Bruder alles
Gott verlassen.

Der Mann, der sich zuletzt zu den anderen gestellt hat, holt einen schwarzen Müllsack aus seinem Rucksack und verteilt den Inhalt. Auf dem kleinen Stehtisch stapeln sich nun neben den Handyhüllen und der Heckenschere auch getragen aussehende Hemden, Baumwollhosen, Ripp-Unterhemden und leichte Pullover. Die anderen Männer beäugen und befühlen die Kleidung. Einer schnappt sich zwei Hemden, knüllt sie zusammen und steckt sie in seine Jackentasche. Ein anderer probiert einen Pullover an und begutachtet sich in der Selfie-Kamera seines Handys. Nach kürzester Zeit sind alle Klamotten vom Tisch. Die Männer verabschieden sich. Zwei ziehen zielstrebig gen Müllerstraße, zwei laufen gemächlich gemeinsam zum U-Bahnhof, einer humpelt mühselig die Nazarethkirchstraße runter.
Coffee Man
„Na, wo haste die Schreibmaschine?“ Harun, oft nur „der Coffee Man“ genannt, erkennt einen bereits nach einem Besuch an seinem Stand wieder. Es ist halb fünf, in dreißig Minuten baut er ab. Noch aber steht eine Schlange vor seinem roten Wagen. Eine junge Frau und ein kleines Kind bestellen heiße Schokolade. Harun malt dem Mädchen ein Teddygesicht in den Milchschaum. Sie streckt ihm eine herzförmige Waffel entgegen: „Für dich!“ Er strahlt: „Die ist ja noch heiß! Frisch gebacken?“ Das Mädchen nickt stolz.

Eine ältere Frau in dickem Mantel setzt sich mit einem Latte macchiato neben Harun und erzählt etwas auf Türkisch. „Ich soll ihm sagen, dass sie ihren Döner mit ihm teilen will“, erklärt Harun, als die Frau aufbricht und deutet auf einen Mann, der mit einem Schild: HUNGRY vor dem U-Bahnhofeingang sitzt. Er geht zu dem Mann, kehrt aber gleich wieder zurück: „Er möchte seinen Platz nicht aufgeben. Und sie kann schlecht laufen und schafft es nicht noch mal zu ihm hin. Jetzt will sie, dass einer von uns sie begleitet und ihm die Hälfte des Döners bringt.“ Für Harun kein ungewöhnliches Anliegen. Er ist auf Märkten großgeworden, hat schon als Kind am Maybachufer beim Verkaufen geholfen. Seit neun Jahren bereitet er auf dem Leopoldplatz Kaffeespezialitäten zu. „Er ist so was wie der Aufpasser hier. Kennt alle und kümmert sich um alles“, erklärt sein Kollege. Harun nickt: „Ist aber auch schon mal schiefgegangen.“ Einmal hätten sich zwei Betrunkene vor seinem Stand geprügelt: „Als ich dazwischen bin, ist plötzlich eine Frau von hinten mit einer vollen Merlot-Flasche auf mich losgegangen.“ Er zeigt auf seine Nase und schneidet eine Grimasse: „Die war davor schöner.“ Dann meint er lächelnd: „Kann schon echt hart sein hier manchmal. Aber ich kann das Traurige mittlerweile ganz gut ausblenden.“ Er strahlt eine Vorbeigehende an. Sie ruft ihm zu: „Hab einen schönen Feierabend! Ich zähl morgen früh auf dich!“

Leben in der Tüte
Im Café Kralle kommt eine Frau an meinen Tisch, der ich auf dem Platz schon ein paar Mal Zigaretten gegeben habe. Sie hebt sich von den anderen um Geld Bittenden ab. Sie ist jung, offen und auffallend eloquent. Ich reiche ihr etwas Kleingeld und sage: „Ich habe dich schon öfter gesehen.“ Sie nickt: „Bin schon länger auf der Straße.“ Sie erzählt, dass sie die letzten Tage bei einem Mann untergekommen sei: „Homo, harmlos, sogar nett.“ Doch der habe sich dann auf einen Süchtigen eingelassen: „Und meinte tatsächlich, er fände Substitution interessant.“ Sie schüttelt den Kopf: „Also ich kann allen, die das interessiert, sagen: Substitution hilft bei Crack nicht. Das Zeug macht schon beim ersten Mal so abhängig, dass du nie wieder davon wegkommst.“ Sie reicht mir die Hand: „Ich bin Frida. Und muss erst mal essen.“ Ich überlege laut: „Ich habe auch Hunger. Wollen wir uns einen Döner teilen?“ Sie nickt. Auf dem Weg zum Nazar Grill bleibt sie im prasselnden Regen vor einem Späti stehen und meint: „Ich habe eine Sozialphobie. Mir wird gerade alles zu viel. Ich will lieber Schokolade und meine Ruhe vor allen Menschen. Können wir vielleicht ein anderes Mal weiterreden?“ Ich nicke. Sie stellt ihre Tüte vor der Tür des Spätis ab und legt ihre Zigarette daneben. Drinnen will ich ihre Schokolade bezahlen. Frida meint: „Ich hätte lieber zehn Euro. Können wir tauschen?“ Sie streckt mir ihre Münzen entgegen. Ohne nachzudenken, gebe ich ihr den Schein und nehme dafür ein paar Münzen aus ihrer Hand. Als wir wieder vor der Tür stehen, liegt da nur noch ihre Zigarette. Ich frage: „Was war denn in der Tüte?“ Sie ruft: „Keine Ahnung, aber es war mein Leben, mein ganzes, beschissenes Leben“, und stürzt ohne Abschiedsgruß los, eilt hastig die Nazarethkirchstraße runter. Ich blicke Frida nach, bis nichts mehr von ihrer Silhouette zu sehen ist und frage mich, was sie sucht.
Ihre Tüte und einen Rückzugsort? Oder Crack?

Wunderheilung bis Weihnachten
„Wenn ihr jeden Dienstag kommt, werdet ihr bis spätestens Ende des Jahres, werdet ihr bis Weihnachten keine Krankheit mehr haben!“, predigt ein Mann in blauem Anzug im „Hilfszentrum“ im Backsteingebäude der neuen Nazarethkirche abwechselnd auf Deutsch und Portugiesisch. „Du musst nicht dulden, mit Schmerzen zu leben, mit Krebs, mit Schizophrenie…“ Beim Stichwort Schizophrenie sieht der Evangelikale die Frau neben mir eindringlich an. Sie nickt heftig. Auch der Mann mit hochrotem Kopf auf der Bank vor mir, der die ganze Zeit unruhig hin und her rutscht, wippt bejahend mit dem Oberkörper. Der Prediger zeigt auf das große Holzkreuz hinter dem Altar: „Jesus hat unsere Sünden und unsere Leiden auf sich genommen. Deswegen ist das Kreuz hier leer.“ Er reicht allen ein kleines Kreuz und betupft es mit Öl: „Ihr müsst nur glauben! Haltet das Kreuz dahin, wo der Schmerz sitzt, und er wird gehen!“ Die Anwesenden tun wie ihnen geheißen. Der Anzugprediger sucht auf seinem Handy einen Psalm raus und blendet ihn auf einem Bildschirm über den Kirchenbänken ein: „Lest alle laut mit!“ Die Stelle aus dem Alten Testament handelt von der Abgabe des Zehnten, also davon, dass Gott ein Zehntel des monatlichen Einkommens zustehe. Er erklärt den Psalm mit einer Analogie: „Wenn man sich auf der Arbeit schlecht behandelt fühlt und meint, man kann Gerechtigkeit herstellen, indem man seinem Chef Druckerblätter wegnimmt, ist das richtig?“ Ein Mann in der ersten Reihe schüttelt energisch den Kopf. Der Prediger ruft: „Und wieso nicht?“ Der Mann sagt: „Weil es nicht mein Eigentum ist.“ Der Prediger nickt und ruft dann mit Nachdruck: „Wer jetzt geben möchte, gibt!“ Er deutet mit seinem rechten Arm in Richtung Empore. Die Frau, die beim Wort Schizophrenie so heftig genickt hat, steht auf, geht vor und steckt einen Zwanzigeuroschein in einen Umschlag.

Schnöder Mammon
Ein Mann bleibt neben dem orangenen Informationsbauwagen auf dem Maxplatz stehen und sieht abwartend zu Infomeister Sven, der gerade in ein Gespräch vertieft ist. Er erzählt, er kenne Sven schon lange, sei oft in dessen Trödelladen gewesen: „Er hat mir auch ein paar meiner Madonnen abgekauft.“ Ich frage interessiert: „Was für Madonnen denn?“ Er erklärt ernst: „Ich habe eine ganze Sammlung Madonnen. Die meisten sind rund 50 Zentimeter groß.“ Er hält inne und erklärt dann mit Stolz in der Stimme: „Alle selbst getöpfert. Im Atelier der Bonhoefferklinik.“ Meist, erzählt er, werde im Werkraum der Klinik eher gemalt; auch er male mehr, als dass er skulptural arbeite, aber die Madonnen – die hätten es ihm angetan. Ich frage ihn, ob er religiös sei. Er überlegt einen Moment, dann meint er nachdenklich: „Schon. Aber ich gehe nicht mehr oft in die Kirche.“ Seine Eltern seien katholisch und protestantisch gewesen: „Ich brauche keine Kirche, um zu glauben.“ Demnächst habe er eine Ausstellung seiner Madonnenfiguren geplant; zwanzig wolle er verkaufen, den Erlös, erklärt er mit leuchtenden Augen, werde er der Kinderkrebshilfe spenden: „Ich hatte schon immer ein Herz für Kinder.“ Sich von den Madonnen zu trennen aber fiele ihm nicht leicht: „Sie sind für mich viel mehr als Figuren.“ In dem Moment kommt Sven dazu und meint: „Wir wissen ja auch, wer die Madonnen im Trödelladen hauptsächlich gekauft hat!“ Ich ziehe interessiert die Augenbrauen hoch: „Wer denn?“ Sven grinst: „Na, er selbst.“ Der Mann erklärt ertappt: „Ich konnte mich einfach nicht trennen.“ Für die Ausstellung aber, beteuert er, werde er es dann schaffen, sie gehenzulassen. Zugunsten der Kinder: „Ich habe dieses Jahr auch an ‚Ein Herz für Kinder‘ gespendet und bin dadurch etwas ins Minus geraten.“ Ich gucke ihn groß an. Er zuckt mit den Achseln: „Ach, was soll’s! Was bleibt denn schon vom schnöden Mammon, wenn wir nicht mehr sind?“
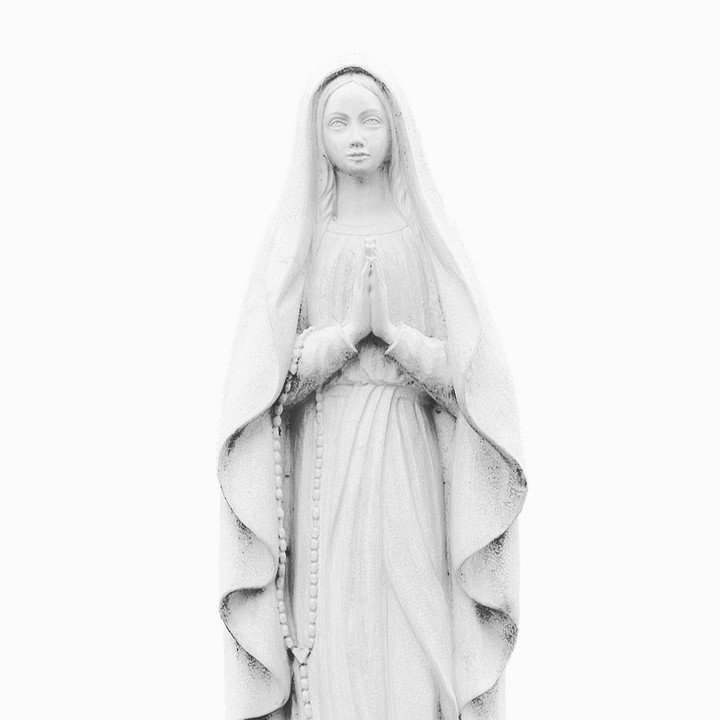
Wumms-Beat
„Wenn nicht, nimm die Handmaschine. Kennste den Spruch?“ Helga lacht, lacht so schallend, dass ihr die Luft wegbleibt und aus dem Lachen ein Husten wird. Seit sie verrentet ist, sitzt Helga jeden Tag auf dem Leo, trinkt Latte macchiato, raucht und kammält, wie quatschen im Rheinland genannt wird, wo sie aufgewachsen ist. Seit 1984 lebt sie auf der Müllerstraße: „So nah, dass ich bis hier spucken kann.“ Nach Berlin verschlagen hat es sie für die Arbeit: „Als ich jung war, hieß es noch, Mädchen müssen nix lernen, die heiraten eh.“ Sie habe in einer Kartonage-Fabrik angefangen und sei später im Verkauf gelandet: „Von Essenswaren, wie es so schön hieß.“ Den Beruf, meint sie, fand sie gut: „Ich mag es, mit Menschen zu tun zu haben.“ Einsam ist sie auch mit Mitte 70 nicht: „Ich habe sehr nette Nachbarn, bei denen ich auch Weihnachten feiere. Auf meinem Stock ist eine dolle WG. Die eine hat am ersten Mai Geburtstag. Da tanzen wir rein. Wenn ich dann um fünf nach Hause komme, bin ich immer froh, dass der Weg eine gerade Linie ist.“ Sie lacht wieder das ihr eigene Lachen. Und erklärt, auf dem Leopoldplatz kenne sie so gut wie alle: „Wenn ich hier Ruhe haben wollte, müsste ich schon meine komplette Visage verstecken, also Mütze, Sonnenbrille und Maske aufziehen. Und mein Maul halten. Meine große Klappe verrät mich.“ Just in dem Moment taucht ein Mann zwischen den Marktständen auf und ruft: „Mensch Helga, erzählst du wieder deine Räuberpistolen? Erzähl auch von den Fünfen, die du um die Ecke gebracht hast!“ Sie sieht auf die Uhr und winkt ab: „Ach, lass mal, jetzt ist Fischzeit!“ Sie erzählt, dass sie sich auf dem Markt gleich zwei Portionen geräucherten Fisch holen werde: „Mein zweiter Mann war aus‘m Norden. Da waren wir oft an der Nordsee. Seitdem gibt’s bei mir freitags Fisch.“ Sie tanzt mit den Armen zu herüberwehenden Elektroklängen und meint: „Bei so Wumms-Beat muss ich immer grooven.“

Die gedruckten Ausgaben mit den Geschichten von Eva-Lena Lörzer wurden auf dem Leopoldplatz verschenkt und sind leider nicht mehr erhältlich. Weitere Episoden und Impressionen der Artist Residency sind aber auf Instagram zu finden: https://www.instagram.com/geschichten.vom.leo/


